- Scientific Team
- ZWF - Mission Statement
- Artistic Research at the MUK
- Annual theme
- ZWF events
- Current news
- Research projects
- Scientific Research Projects
- Overview Scientific Research Projects
- Beethoven
- The Austro-German Melodrama and its Film Music
- The Impact of Sound on the Screenplay, 1927—1934
- Deutschsprachige und anglophone Formenlehre der Nachkriegszeit
- The woman of my dreams
- Die Illusion der Freiheit
- ELEMU and the art of interaction
- European Landscapes
- Experiment Notation
- Film score for conveying ideology
- Gustav Mahlers Compositional Logic
- MUK History - Contemporary History
- Hellerau-Laxenburg
- Interdisziplinäre Mittelalterstudien
- It’s a Match!
- Cultural participation
- LSBTIQ* Bewegungen und Demokratie: Geschichte, Gegenwart und Zukunft
- MUK meets IFK
- Salon Différance
- Research on Dance Archives
- Theatre & Consciousness
- Urban Music Studies
- Hidden Paintings
- From Text to Performance: Literary Em-bodiment
- Wachau Myth
- Artistic Research Projects
- Overview Artistic Research Projects
- Archive of search
- Cabaret of Old News
- Composer/Performer Relations
- DANCR - an AI tool for dance research
- The vanishing of the archive
- The Art of Inclusion
- Dynamics of condensed systems
- Elementary Music Theatre
- Experiment Empathy in collaborative Improvisation
- Fiction and Research
- Franz Schubert — Der Akt des Dichtens in seiner musikalischen Darstellung
- Gender and violence
- Inter-university research network Elfriede Jelinek
- Art and politics
- The correlation between the gaze, the voice,...
- Method of Vienna
- Notation and performance
- Suite Mixtur
- Transforming Instrumental Gestures
- Word.Music.Theatre
- Arts-based research (EEK)
- Overview EEK
- Artist in Residence Programm
- Artistic Research
- Moving images of Jewish culture / film and exile
- Carte blanche
- Didactics of Contempary Music and Composing
- Entente Musicale
- IGP and Community Music
- Jazz und seine Einflüsse aus anderen Musiktraditionen
- Thinking music
- Operetta
- Poème électronique
- City and sound
- Viennese Original Sources
- vienna.composers@MUK
- Zeitgenössische klassische Musik & Jazz
- Scientific Research Projects
- Gender & Diversity
- Research Service
- Competence Centre Film | Film Music
- Joint Research Network E. Jelinek
- Teaching
Current news
Rezension "Barocke Tänze und ihre musikalische Umsetzung"
Eine Rezension von Karsten Erik Ose der Zeitschrift TIBIA
Das vorliegende, gebundene, mit Bildern und Notenbeispielen liebevoll aufgemachte Büchlein ist ganz wunderbar, und etwas Vergleichbares gibt es derzeit nicht auf dem Markt. Über einen QR-Code gelangt der Leser außerdem an Videomaterial, welches die Zusammenarbeit der Autoren mit ihren Studentinnen und Studenten dokumentiert. Wer immer sich in Theorie und
Praxis mit dem Thema des höfischen Barocktanzes beschäftigt, ob als Profi oder als Laie, sollte es umgehend bestellen. Als Autorenteam haben sich die Recherche und Arbeit geteilt: Der unlängst verstorbene Musikwissenschaftler Reinhold Kubik, die Expertin für historische Schauspielkunst und barocke Choreographien Margit Legler und der Oboist Andreas Helm – eine sinnvolle Kombination; denn es fehlen weder der musikologische Hintergrund, das fundierte Detailwissen um Schrittfolgen, Charakter und Tempo der höfischen Tänze noch der kulturhistorische Bezug – und eben an jenem Neben- und Miteinander von Informationen hat es bislang in der Sekundärliteratur gemangelt. Zudem stellt das „Lehrbuch“, wie es im Untertitel heißt, die wesentlichen Fakten kurz und knapp dar, ohne sich in Details zu verlieren oder die Dinge mit dem Anspruch lexikalischer Vollkommenheit zu vertiefen, sodass sich jedermann rasch unter den entsprechenden Stichworten – wie Allemande, Courante, Sarabande, Gigue etc. – einen Überblick über die für die musikalische Praxis relevanten Fakten verschaffen kann. Dass dies für den Musiker – und insbesondere für den Spieler von Blasinstrumenten – unumgänglich ist, um zu einer angemessenen, wenn nicht sogar „historisch informierten“ Interpretation zu gelangen, liegt auf der Hand; denn weite Teile des musikalischen Repertoires aus der Zeit des 16. bis 18. Jahrhunderts sind französisch geprägt und also unmittelbar im Kontext des höfischen Tanzes zu sehen oder haben zumindest einen Bezug zum Thema, und immer wieder steht der Musiker vor der Frage, was es denn nun etwa mit dem Menuett auf sich hat, welches Tempo zu welcher Entstehungszeit wohl angemessen ist, ob es Parallelen zwischen dem getanzten und dem gespielten Typus gibt, und ob das gerade einzustudierende Stück überhaupt zum Tanzen gedacht war oder nicht ... Fragen über Fragen, mit denen das vorgelegte „Lehrbuch“ den Schüler nicht alleine lässt. Möchte man ein Fazit ziehen: Uneingeschränkt zu empfehlen!
Margit Legler/Andreas Helm/Reinhold Kubik: Barocke Tänze und ihre musikalische Umsetzung
Barocke Tänze und ihre musikalische Umsetzung
Wien 2024, Hollitzer Wissenschaftsverlag, ISBN 978-99094-237-6
https://www.moeck.com/de/tibia/tibia-online/artikel.html?article=2554
MUK: AUFWIND FÜR DIE FORSCHUNG. ERFOLGREICHE DRITTMITTELAKQUISE IM STUDIENJAHR 2024/25 (MUK/APA/RK)
![[Translate to English:]…](/fileadmin/_processed_/8/9/csm_csm_Gruppenfoto_Forschung-im-Aufwiund-an-der-MUK_Jaenner-2025-c-MUK_a39284a9ea_481d60ad09.jpg)
Drittmittel-finanzierte Forschung an der MUK. Im Bild v.l.n.r.: Univ.-Prof. Joonas Lathinen PhD (Stv. Leitung Doktoratsstudium), Hanna Praßl-Wisiak BA BA MA MA und Dr.in Julia Meer (Forschungsservice), PD Dr. Claus Tieber, Univ.-Prof.in Margit Legler, Univ.-Prof. Dr. Eike Wittrock sowie PD Dr.in Ass.Prof.in Rosemarie Brucher, Vizerektorin für Wissenschaft und Forschung an der MUK. Foto © MUK, Jänner 2025. Foto unter Hinweis auf Urheber zur Veröffentlichung rechte- und gebührenfrei.
Fast eine Million Euro zusätzliche Forschungsmittel konnte die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) akquirieren. Damit profiliert sich die Universität nachhaltig als lebendiger Forschungsstandort mitten in Wien.
Das Studien- und Förderjahr 2024/25 bringt für die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien positive Nachrichten: Sieben neue Forschungsprojekte werden von Fördergeber*innen wie dem Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF), der VolkswagenStiftung und der Stadt Wien unterstützt. Die bewilligten Mittel in der Höhe von insgesamt 990.000 Euro fließen der Institution zur Schaffung von zusätzlichen Forschungsstellen zu und ermöglichen die Drucklegung von Forschungsarbeiten.
SCHNITTSTELLE FORSCHUNGSSERVICE
Die Forschungsprojekte danken sich der Initiative einzelner Forscher*innen, die ihre Projekte in enger Zusammenarbeit mit dem Forschungsservice der MUK entwickeln. Das Forschungsservice wurde von der Vizerektorin für Wissenschaft und Forschung, PD Dr.in Ass.Prof.in Rosemarie Brucher, 2019 implementiert.
Drittmittel-finanzierte Projekte ergänzen und bereichern die laufende Forschung von MUK-Wissenschafter*innen und -Lehrenden in den Bereichen Musiktheorie und Komposition, Film/Filmmusik und Medien, Gegenwartstheater und Kunstvermittlung, Tanz und Performance Art. Darüber hinaus vernetzen sie die Universität mit internationalen Partner*innen und kommen auf dem Wege von Veranstaltungen, Begegnung und Dialog nicht nur den Studierenden, sondern auch der Stadt Wien zugute.
THEMEN DEMOKRATIE, FILM UND TRAUM, MIKROTONALITÄT UND THEATER
So etwa erforscht der Filmwissenschafter PD Dr. Claus Tieber in seinem auf vier Jahre anberaumten FWF-Projekt über den Einfluss des Tonfilms auf das Drehbuch 1927–1934 jenen Medienwandel, der durch den Umbruch vom Stummfilm zum Tonfilm stattfand. Ebenfalls bereits gestartet ist das FWF-Forschungsprojekt der Kultur- und Medienwissenschafterin Dr.in Marietta Kesting, das zukunftsträchtige Träume in den Künsten unter die wissenschaftliche Lupe nimmt.
Mit März wird ein umfassendes Forschungsprojekt zur Bedeutung queerer Bewegungen für die Demokratie ausgerollt. Das von der deutschen VolkswagenStiftung für mehr als drei Jahre finanzierte Projekt steht unter der Leitung von Dr.in Andrea Rottmann von der FU Berlin und bringt Partner*innen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft in Deutschland und Österreich zusammen. Dr. Eike Wittrock, Professor für Tanzwissenschaft an der MUK, wird in diesem Rahmen mit dem Wiener Theatermacher Dr. Gin Müller Theaterworkshops zu queerer Geschichte entwickeln. Weitere Partner*innen sind die JLU Gießen und der Dachverband deutschsprachiger queerer Archive, Bibliotheken und Sammlungen. Acht Prozent des Gesamt-Fördervolumens von rund 1,4 Millionen Euro fließen dabei an die Forschenden an der MUK.
An der Schnittstelle von Komposition, Improvisation und Interpretationsforschung ist die international und transdisziplinär angelegte Erforschung von Aspekten der Mikrotonalität im Jazz angelegt. Das FWF-Projekt wird im Rahmen des PEEK-Programms zur Entwicklung und Erschließung der Künste unter Leitung von Lars Seniuk MMus durchgeführt, Professor für Trompete, Ensemble und Bigband an der MUK.
Die Mikrotonalität im Jazz steht auch im Zentrum des Dissertationsprojekts von Philipp Gerschlauer, dessen Studie zur Entwicklung und Implementierung eines mikrotonalen Keyboards von der Kulturabteilung der Stadt Wien gefördert wird. Angewandte Resultate der historischen Tanzforschung werden im Projekt der MUK-Professor*innen Margit Legler und Andreas Helm für die Pädagogik und Rezeption der Musik des Barock-Zeitalters fruchtbar gemacht. Die Forschungsergebnisse sollen in Buchform publiziert und durch Videoclips ergänzt werden. Unter dem Titel Schauspiel & Doppeltes Bewusstsein wurde nicht zuletzt die Förderung der Drucklegung einer Studie von Vizerektorin Rosemarie Brucher bewilligt, die eine neue Perspektive auf die durch psychowissenschaftliche Diskurse beeinflusste Entwicklung der Schauspieltheorie zu Beginn des 20. Jahrhunderts darlegt.
ÜBER DIE MUK
Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) ist eine öffentliche Institution, die den Studierenden an den Fakultäten Musik und Darstellende Kunst eine leistbare, exzellente künstlerische, wissenschaftliche und kunstpädagogische Berufsausbildung bietet. Mit derzeit etwa 900 Studierenden und mehr als 280 namhaften Lehrenden vereint die MUK international herausragende Künstler*innen der Bereiche Musik, Tanz, Schauspiel, Gesang und künstlerische Forschung.
An den Standorten Johannesgasse, Bräunerstraße und Singerstraße ist der Innenstadt-Campus dieser einzigen Universität der Stadt Wien wesentlich in das urbane und kulturelle Leben Wiens eingebunden. Als Tochtergesellschaft der Wien Holding steht die MUK zur Gänze im Eigentum der Stadt Wien und ist durch diese Trägerschaft eng mit den anderen Kulturbetrieben vernetzt.
Publikation
Rosemarie Brucher
PROΣKENION - Studien zu Theater und Performance 4
2024
ISBN 978-3-8498-1994-1
283 Seiten
E-Book (PDF-Datei), ca. 2 MB
Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert avancierten dissoziative Bewusstseinsspaltungen zu einem zentralen Forschungsthema. Verfahren der Hypnose und Suggestion sowie Zustände des Somnambulismus und der Trance rückten ins Zentrum psychowissenschaftlicher Aufmerksamkeit, um Aufschluss über die „verborgenen Sphären“ des Ich zu erlangen. Diese Entdeckungen wurden auch von Theatertheoretiker*innen aufgegriffen, um die schauspielerische Fähigkeit zur Verwandlung und zur Darstellung unterschiedlicher Charaktere besser zu verstehen. Die vorliegende Studie untersucht mit Fokus auf die vier Schauspieltheoretiker Constant Coquelin, William Archer, Max Martersteig und Edward Gordon Craig, wie diese die neuen psychologischen Erkenntnisse zu Bewusstseinsspaltungen in ihre Überlegungen einbezogen. Anhand ihrer Schriften aus den Jahren 1880 bis 1910 wird aufgezeigt, wie sich durch den Einbezug bewusstseinstheoretischer Überlegungen die traditionelle Auffassung von Identität und Identifikation im Schauspiel veränderte.



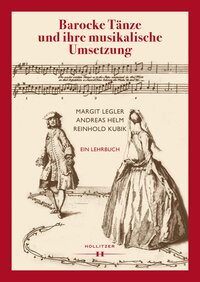
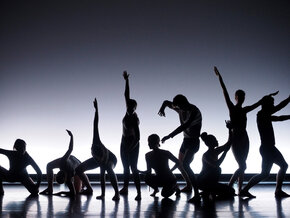
![[Translate to English:]… [Translate to English:]…](/fileadmin/_processed_/7/8/csm_csm__Gruppenfoto-Eroeffnung-Doktorat_2024-10-14_3d64718f8a_ffa411234f.jpg)